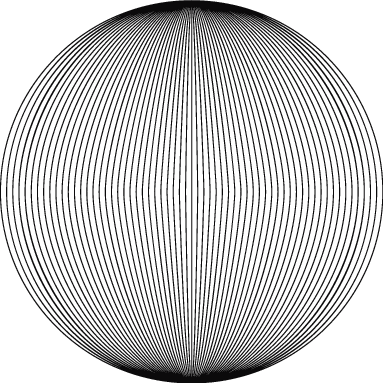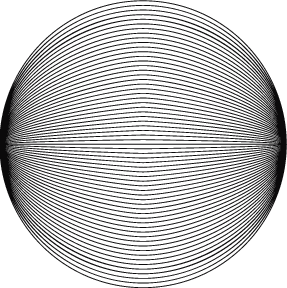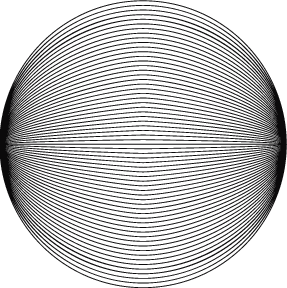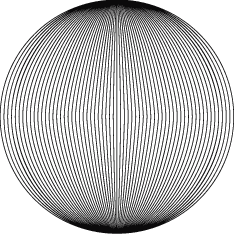Vorneweg, zum Ende, das übliche Ritual, also die
„herbst“-Bilanz: Steigerung der Auslastung mit 40.000 Besuchern auf
92,88 %, dazu über 600 Künstler, Theoretiker und sonstige Teilnehmer
aus insgesamt 52 Nationen. Die Cash-Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr
um 50 % gestiegen, die Reduzierung des Budgets um 250.000 Euro
ausgeglichen durch das bisher stärkste Sponsoring. Dazu war der Herbst
ungewöhnlich sonnig, was für einen schon fast störenden Zulauf im
Festivalbezirk Mariahilf sorgte.
Und dass der Chefdramaturg Florian Malzacher 2013 die Leitung des
Theaterfestivals „Impulse“ in Nordrhein-Westfalen übernimmt, ist auch
ein Beweis für die Qualität des „herbst“, andererseits auch ein Verlust
für ihn.
Ein Motto gleicht einem Sinn-Container, in den sich so ziemlich jedes
Programm transportieren lässt. Das Motto des diesjährigen „herbst“ war
da in seiner klassischen Unbestimmtheit keine Ausnahme: „Zweite Welt“,
Grenze zwischen Realen und Imaginärem, Paradigmenwechsel …
Und wie war er nun, der „herbst“? Sieht man die Theater - bzw.
Performanceabende als Kernkompetenz des Festivals, ist mit ihnen das
Motto „Zweite Welt“ ziemlich schlüssig interpretiert worden.
Wörtlich nimmt Eszter Salamon das Motto in ihren „Tales Of The
Bodiless“, indem sie vier radikale Alternativen zu der von menschlicher
Spezies erlebten, also konstruierten Welt anbietet: Erst das „Moor“ aus
einer überzeitlich/zeitlosen Perspektive, dann aus der Sicht von Hunden,
die als beste Freunde des Menschen übrig geblieben sind; schließlich
gibt es die Welt der „Substituierten“, in der sexuelle Unterschiede nur
mehr „körperlos“ bzw. mit Körper („körpervoll“) definiert werden und
zuletzt „Punkte“: Ergebnis eines nur mehr „bakteriellen Sex“ der
„Substituierten“. Nicht mehr die Reproduktion der Spezies ist Ergebnis,
sondern deren Partikelnachwuchs, Bakterien, Myriaden von
Mikroorganismen. Das klingt abgehoben, aber es fällt einem dazu auch
„grey goo“ ein, die Horrorvision eines weltfressenden Schleims aus wild
gewordenen Nanopartikeln. Salomons Inszenierung arbeitete erst mit
völliger Dunkelheit, verschärft durch ohrenbetäubende Toncluster, dann
mit pompösen Licht- und Nebelspielen – wie immer im Mumuth, dem
postmodernen Tempel für Hightech-Pompöses. Eszter Salamons
überzeitliche, eben nicht anthropozentrische Szenarien bestechen aber
auch durch fabelhafte, absurde Dialoge, geschrieben für ihre „Hunde“.
Die spannendste Show bot der Amerikaner Miguel Gutierrez mit „Heavens
what have I done“. Schon der Titel signalisiert lustvolles Entsetzen
über das Vorführen persönlichster Probleme. Schlampig-dicklich wie der
Dokumentarist Michael Moore saust Gutierrez mit einem Rucksack durch die
Zuseherreihen, die er erst einmal dazu bringt, sich ganz woanders
hinzusetzen. Unablässig über sich und seine Kunst, also sein Leben
redend, leert er seinen Rucksack, verstreut Bücher über den Boden und
baut die Bühnentechnik währenddessen selber auf. Sich bis auf die
Unterhose entkleidend, um das absurde Paradiesvogelkostüm seines
französischen Freundes plus einer Marie-Antoinette-Perücke anzulegen,
fängt der Tänzer, Eventkünstler, Kommunikator und Choreograf frei nach
Heinrich Heine die ganze Welt im Mikrokosmos seines Lebens ein. „Denn
jeder Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm lebt und mit ihm zugrunde
geht“. In seiner nur scheinbar bescheidenen Aufführung verbindet
Gutierrez das Schrille mit dem Sanften, das Noble mit dem Kitsch, das
Hochartistische mit dem Alltäglichen. Nach einer wahnsinnigen
Tanzeinlage singt er im Duett mit Cäcilia Bartoli zu deren CD mit
Vivaldi-Liedern. Selten auf so hohem Niveau über eine gleichzeitig
selbstreflexiv-hektische und schmerzerfüllte Confessio gelacht …
Am weitesten treibt Jan Ritsema mit „Shakespeare`s As You Like It, A
Body Part“ die dramaturgische Auflösung. Ihm und seiner Truppe geht es
um das Prozesshafte ihrer Arbeit, wobei sie sich organisatorisch bzw.
hierarchisch so wenig wie möglich fixieren. Die Spieler präsentieren
ihre banalen, pointenlosen, bestenfalls absurden Parts – etwa simple
Entspannungsübungen, eine (nicht einmal parodierte) Talkshow, Fragen, ob
man lieber von Gaddafi oder Sarkozy aufs Kreuz gelegt werden würde,
oder den Vortrag eines Erschossenen. Programmatisch sagt Ritsema: „I am
not interested in theatre that looks like theater.” Das postmoderne
"Anything goes" wird aber ohne die übliche, postmoderne Virtuosität
vorgeführt. Die Zuseher, nur gelegentlich ins Geschehen mit einbezogen,
werden anfangs vom heftigen Wunsch erfüllt, zu gehen. Aber schließlich
entwickelt diese gleichgültige Banalität doch ihren Sog. Sie werden zu
Statisten in einer Dokumentation, die aus dem – mit einer Handvoll
Amateurkameras zu locker ausgeführten Drehkommandos – gedrehten
Material entstehen soll. Wir filmen und indem wir Bilder von uns
machen, existieren wir; das banale Medium Video muss die Banalität
legitimieren. Die Theaterarbeit erinnert mit ihrer Neugier auf das
Prozesshafte, mit dem Verzicht auf Effekte, mit der zur „Kunst“
erklärten Grundlagenforschung an Architekten vor der Postmoderne, die
den Architekturbegriff ähnlich unbefangen überschritten. Buckminster
Fuller etwa, oder Yona Friedman.
Die schwedische Choreografin Gunilla Heilborn übernimmt für „Potato
Country“ mit dem Aufritt einer Moderatorin ebenfalls triviale
FS-Formate. Dabei überlässt sie aber, anders als Jan Ritsema, nichts dem
Zufall. Es werden Fragen gestellt (Was sind die unglücklichsten Zeiten?
Was ist Happiness? Wie steht es um die Frauenrechte in China?),
grundsätzliche und komische, manchmal fällt beides zusammen. Sieben
Tänzer singen, spielen Akkordeon oder erzählen Tagesabläufe. Technisch
perfekt verzichten auch sie darauf, diese Perfektion vorzuführen und
stellen sich im Gegenteil häufig „ungeschickt“ an. Auch ihre Kostüme
sind von kalkulierter Bescheidenheit. Die elektronische Musik von Kim
Hiorthoy mit ihrem Understatement verleiht dem Abend mit seinen
sparsamen Leitmotiven – das einfache Leben im „Potato Country“ liegt
vielleicht in Irland – seinen Charme. Eine sehr gekonnte, kunstsinnige
Aufführung auf der Höhe der Zeit.
„Welche Welt?“ Die „Jungen“ aus dem „Stall“ von UniT, Jörg Albrecht,
Gerhild Steinbuch und Johannes Schrettle stellten diese schlaue Frage.
Und vor allem Schrettles Antwort mit „Wie wir es tun sollten“ kommt auf
den Punkt. Er spielt mit seinem Text die Ratschläge und
Handlungsanweisungen der „Ersten Welt“ frech zurück. Wobei seine Truppe,
die „zweite liga für kunst und kultur“, hauptsächlich bestehend aus
einer Blondine mit Stoneface, einem toughen, durchtrainierten
Schauspieler und einer genialen Slapstickerin, dem Publikum den normalen
Widersinn mit böser Komik zwischen Rene Char und Karl Valentin
entgegenhalten.
„Wie wir es tun sollten“ war nicht nur die beste der „kleinen“ Arbeiten,
sie lässt auch die Platzhirschen vom Theater am Bahnhof zumindest mit
ihrer aktuellen „herbst“-Produktion „alt aussehen“. Deren „Time to get
ready for love“ leidet an Unentschiedenheit: Geht es darum, lustvoll
alte (unhörbare) Schlager nachzuerleben – die Texte werden simultan von
einer mp3-Einspielung nachgesprochen – oder um die Fernsteuerung von
Künstlern bzw. Konsumenten? Auch Gastregisseur Robin Arthur inszeniert
das Vorstellen der Songs als reduziertes Verfahren. Das hat manchmal
Charme, nur zieht sich der Abend ungebührlich in die Länge. Lorenz Kabas
finalisiert ihn schön sentimental mit „Ev´ry Time We Say Goodbye“, aber
das war doch nicht die Idee. Oder?
Rodrigo Garcia wirkte mit seinem Fast-Skandal, dem bildergewaltigen
„Golgota Picnic“, etwas out of time. Der hochprozentige, an Lautréamonts
„Gesänge des Maldoror“ (1648) erinnernde Text, Nacktheit auf der
Bühne, Ausspucken von Essensbrei, Zitate auf die Wiener Aktionisten
oder das Turiner Leichentuch, immer begleitet von simultanen
Live-Video-Projektionen, ergeben eine etwas abgestandene Avantgarde. Die
Qualität des Abends bestand in seinem überwältigenden Reichtum der
Bilder, von denen einige sehr frisch wirkten: Wenn z. B. ein am Boden
Liegender mit fleischartigen Substanzen bepflastert wird und dabei, die
Zigarette im Mund, ungerührt weiterpafft; oder wenn die den Bodenbelag
bildenden Brötchen in hohem Bogen von den Füßen der Laufenden
wegstieben.
Die aufregendsten 20 Minuten des „herbst“ boten "Les spectateurs" von
Lotte van den Berg in der List-Halle. Ganz oben auf der Tribüne, im
Rücken der Zuseher, psalmodiert, singt, heult eine schwarze Sängerin,
während unten im Halbkreis aufgestellte Gebläse mächtig in einen Haufen
Plastik hineinblasen. Die wirbelnden Plastikfetzen entpuppen sich als
verzerrte, menschliche Figuren, die bis an die Decke hochkreiseln:
Dschinns, Gespenster des Kolonialismus, Seelen in Panik, was weiß ich.
Danach, während im Hintergrund das Bestattungsritual läuft, wieder
erstarrte Schauspieler, eine onomatopoetische Sprechperformance, diesmal
einer Weißen, und schließlich deren freundliche Aufforderung: „Wir
wollen mit euch etwas trinken.“ Die Mischung aus Animismus und Hightech
mutiert zu einer Art politischen Kommunion. Immerhin, der Rotwein ist
von Winkler-Hermaden. Und natürlich verzichtete auch diese leicht
gravitätische Aufführung auf jede „Illusion“.
„Zwei Welten“ – Motto-Mission accomplished. Die Inszenierungen waren
geprägt von der Durchlässigkeit zwischen Bühnenillusion und banaler
Realität, von dramaturgischer Spannung und gleichzeitig Nonchalance
gegenüber Effekten. Das Herstellen der Bühne als Teil der Aufführung
zählt ebenso dazu wie das Gleichsetzen von der Rolle des Schauspielers
mit seiner Person. Und ähnlich unbefangen wird manchmal auch der
Unterschied zwischen Zusehern und Akteuren ignoriert.
Und die herbst-Eröffnung „Cesena“ von Anne Teresa De Keersmaeker?
Wunderbarer Gesang von Björn Schmelzers Vokal-Esemble graindelavoix. Nur
ist die List-Halle nicht der Palais des Papes in Avignon, und
Lichtspiele in der Schuhschachtel sind kein Sonnenaufgang in der
Provence. Den hätte allenfalls Lichtkünstler Olafur Eliasson geschafft …